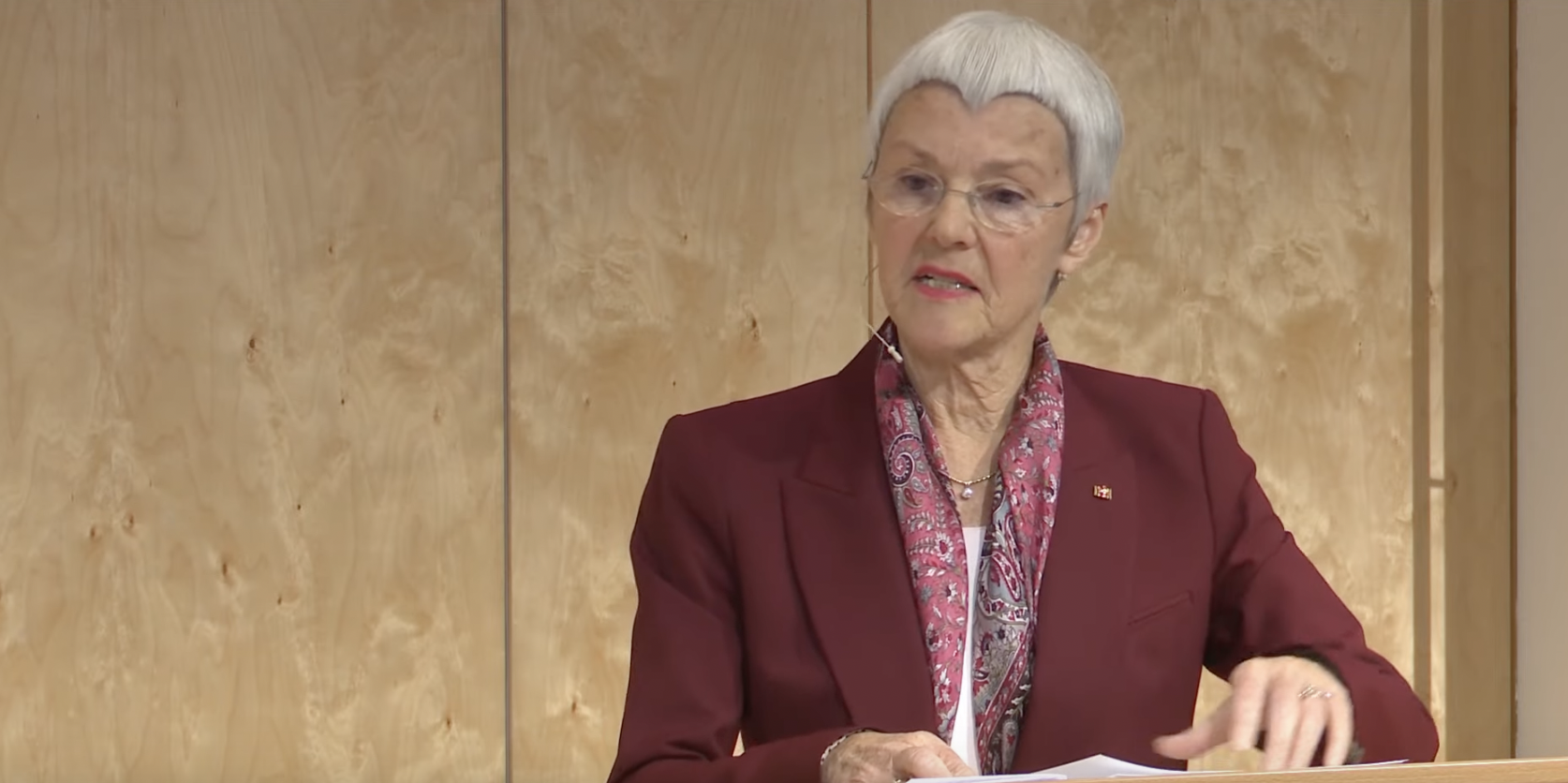Wir geben euch hier die ersten rund 50 Minuten eines spannenden Vortrages von Dr. Gabriele Krone-Schmalz an der Volkshochschule Reutlingen wieder. Basis ist ein von der VHS Reutlingen auf YouTube veröffentlichter Mitschnitt, wobei wir das von YouTube zur Verfügung gestellte Transkript verwendeten, um hier den Vortrag in Auszügen veröffentlichen zu können.
Gabriele Krone-Schmalz gehört zu den prominentesten langjährigen TV-Journalistin in Deutschland, der EU. Sie war zum Ende der Sowjetunion zwischen 1987 und 1991 die ARD-Korrespondentin für Russland und erlebte so den Zusammenbruch der Sowjetunion hautnah, ebenso den Fall der Berliner Mauer. Sie ist Wissenschaftlerin und Bestseller-Buchautorin (u.a. „Eiszeit“) und ausgewiesene Osteuropa-Expertin, sowie Russland-Expertin.
Bis heute ist sie Dutzenden Millionen Deutschen als das zentrale Gesicht für die Russlandberichterstattung des Öffentlich-Rechtlichen Fernsehens bekannt. Sie gehört nach wie vor zu den Premium-Journalisten in Deutschland. Wenn sie sich äußert, hört man zu. In dem Vortrag an der VHS Reutlingen kritisiert sie die Einkesselungspolitik der USA gegen Russland als Mit-Ursächlich an dem Ukraine-Krieg. Zudem räumt sie mit der Mähr auf, Russland habe Georgien vor vielen Jahren angegriffen. Eine von der EU beauftragte Kommission haben schon vor Jahren das Gegenteil belegt, nämlich dass Georgien Russland angegriffen habe.
Auch die Ukraine wird kritisiert, dafür, dass sie das Minsker Abkommen 2015 fast komplett ignoriert habe, sich stattdessen seit Jahren durch den Westen aufrüsten lasse und auch dieses den Einmarsch Russlands erst provoziert habe. Vor allem die USA nähmen dabei eine zündelnde Funktion ein: Denn im Gegensatz zu Russland, das kaum über Militärbasen im Ausland verfüge, verfügten die USA rund um Russland mittlerweile über Hunderte Militärbasen, die auch für Russland bedrohlich seien, da so Russland beispielsweise der Zugang zu den Weltmeeren abgeschnitten werden könne.
Dass das Portal „T-online.de“ im Zusammenhang mit Gabriele Krone-Schmalz sich mal wieder als Schmierenportal betätigt, ist nicht zum ersten Mal. In den vergangenen Jahren ist das Portal des öfteren mit Schmierenartikeln aufgefallen, die es zum Ziel haben, andere verächtlich zu machen und an den Pranger zu stellen, spalterisch zu wirken und die Welt einfältig in schwarz und weiß zu pinseln. Selbst vor Hetzartikeln macht T-online.de des öfteren nicht halt. Wir ersparen es uns darauf jetzt im Näheren einzugehen und leiten über auf den klasse Vortrag von Gabriele Krone-Schmalz.
Vortrag Gabriele Krone Schmalz an der VHS Reutlingen:
„…. Schön, ich freue mich sehr, dass Sie so viele sind, dass das Interesse so groß ist und dass sie sich nicht haben abhalten lassen herzukommen. Da freue ich mich sehr drüber. Ja, wir hatten in Deutschland immer schon eine schmale Debattenkultur. Das ist nicht von mir, leider. So hat das neulich Klaus von Dohnanyi ausgedrückt, dieser besonnene SPD-Politiker der in den 1980er Jahren Erster Bürgermeister in Hamburg war. Und da das so ist, läuft man Gefahr, unter die Räder zu geraten, wenn man andere Argumente bringt, andere Meinungen äußert als die, die den Mainstream in Politik und Medien bilden.
Das ist nicht gut. Man muss die Argumente ja nicht teilen. Aber sie nicht zuzulassen oder sie von vornherein als Propaganda oder ähnliches zu diskreditieren, das schadet der Demokratie, auf die wir doch zu Recht stolz sind.
Eine Demokratie muss es aushalten, das gestritten wird. Das geht ja auch respektvoll. Doch sobald sich eine Gesellschaft radikalisiert ist es vorbei mit der Streitkultur. Und das geht so:
Die Ideologisierung und vor allem die moralische Aufladung von Debatten läuft auf eine Polarisierung hinaus, die fast zwangsläufig zu einer Radikalisierung führt. Die ist nicht schlecht. Aber ohne, wäre trotzdem besser.
Wir waren bei der Radikalisierung. Denn wer sich moralisch auf der richtigen Seite wählt, der nimmt für sich in Anspruch seinen Standpunkt buchstäblich mit allen Mitteln durchzusetzen.
Denn das tut er ja für die gute Sache wer das nicht einsieht, steht automatisch im Abseits. Die Meinungskorridore sind in der Tat bedrückend eng geworden nicht nur was das Thema Russland betrifft. Das bedeutet: Andersdenkende sind kein selbstverständlicher Bestandteil unserer grundsätzlich lebendigen offenen Gesellschaft mehr, sondern Störfaktoren, die man besser gar nicht erst zu Wort kommen lässt oder sogar Feinde, die es mit aller Konsequenz auszugrenzen gilt.
Akteure auf der guten Seite müssen sich auch überhaupt keine Mühe geben ihr Verhalten zu erklären oder gar zu rechtfertigen. Denn Böses muss bekämpft werden Was gibt es denn da zu diskutieren. Das Problem dabei zum einen, sind die Dinge. Selten so schwarz-weiß wie sie da Einfachheit halber dargestellt werden…
… Moral kann niemals politische Analyse und daraus abgeleitetes kluges politisches Handeln ersetzen damit plädiere ich nicht für eine Politik ohne Moral. Ganz im Gegenteil für mich zeichnet sich moralische Außenpolitik zum Beispiel dadurch aus, dass man die Dinge bis zu Ende denkt und dass man darauf achtet, dass es den Menschen dient und nicht irgendwelchen Prinzipien. Und noch etwas: Ein Kardinalfehler in Politik und Medien besteht darin, Momentaufnahmen als Realität zu verkaufen.
Realität ist immer ein Prozess. Alles hat eine Vorgeschichte. Um Realität zu begreifen, ist es nötig, über Chronologie Bescheid zu wissen. Ursache und Wirkung nicht zu verwechseln. Zumindest zu versuchen, herauszufinden, wer in einer Angelegenheit agiert und wer reagiert.
Diese grundsätzlichen Bemerkungen, die wollte ich loswerden, bevor ich auf die konkrete Situation zu sprechen komme, in der wir uns mit Blick auf Russland und die Ukraine befinden.
Ich gebe zu und ich habe das ja auch entsprechend publiziert, dass ich mich mit der Einschätzung geirrt habe, Russland würde doch niemals die Ukraine angreife. Ich bin lange davon ausgegangen, dass der Aufbau dieser gigantischen militärischen Druckkulisse an Russlands Westgrenzen Ende des vergangenen Jahres, Anfang dieses Jahres, so überzogen und riskant er auch sein mochte, einem einzigen Zweck diente nämlich ernst zu nehmende Verhandlungen mit dem Westen zu erzwingen.
Ich habe nicht damit gerechnet, dass Russland tatsächlich in die Ukraine einmarschiert und es macht für mich bis heute keinen Sinn, denn es widerspricht in mehrfacher Hinsicht russischen Interessen. Russland wird noch die nächsten Jahrzehnte damit beschäftigt sein, verlässliche staatliche Strukturen zu schaffen und seine Wirtschaft zukunftstauglich zu machen.
Ein Krieg ist dabei ein ruinöser Störfaktor. Also warum das Ganze? Die westlichen Deutungsmuster schwanken zwischen Putin ist krank oder verrückt und Putin war ja schon immer ein Monster und jetzt zeigt er sich auch so. Es widerstrebt mir als Journalist in solchen Fällen immer gleich zu einer Psychopathologisierung zu greifen. Ganz gleich, ob es sich um Trump oder Putin oder sonst wen handelt. Dieses eindimensionale Erklärungsmuster scheint mir wenig hilfreich zu sein mit Blick auf potenzielle Lösungen für tatsächlich vorhandene Probleme.
Es ist viel interessanter und auch zielführender, herauszufinden. was der eigentliche Auslöser des Einmarsches war. Denn er macht nicht zuletzt zu dem Zeitpunkt, als er begann, mit Blick auf russische Interessen, nach wie vor keinen Sinn. Wenn es von vornherein die Absicht Putins gewesen wäre, wie viele jetzt behaupten, dann hätte der Überfall von vor…. knapp zehn Jahren stattfinden müssen, als die Ukraine noch nicht so stark westlich aufgerüstet war.
Aber jetzt es macht keinen Sinn. Im Hinterkopf sollte man vielleicht folgendes haben. Am Februar, also auf den Tag genau ein Jahr vor Kriegsbeginn, hat der ukrainische Präsident Selensky einen Dekret erlassen indem er die Rückeroberung der Krim quasi angeordnet hat.
Und einige Zeit später begann man damit ukrainische Streitkräfte… im Süden und Osten des Landes zusammenzuziehen, was Russland natürlich nicht verborgen geblieben ist. Parallel dazu fanden zwischen dem Schwarzen Meer und der Ostsee diverse Nato-Manöver statt und die Zahl der Aufklärungsflüge der USA an der Ukrainisch russischen Grenze stieg nennenswert.
Ich zitiere in dem Zusammenhang Harald Kujath, den ehemaligen Generalinspektor der Bundeswehr und Vorsitzenden des NATO Militärausschusses. Der hat folgendes gesagt: Die ukrainischen Streitkräfte führten unter Verstoß des Minsker Abkommens im Donbass Einsätze mit Drohnen durch, darunter mindestens ein nachgewiesener Angriff auf ein Kraftstoffdepot in Doniewsk im Oktober [Anmerkung Redaktion: Gemeint ist wohl der Oktober 2021).
Die Opferzahlen im Donetska und Luganska Gebiet vor dem russischen Einmarsch durch die permanenten ukrainischen Angriffe, die wurden bei uns ja eher nicht registriert. Zusätzlich muss man wissen, dass noch im November letzten Jahres [Anmerkung Redaktion: 2021] die USA und die Ukraine ein Abkommen über strategische Partnerschaft geschlossen haben, in dem sowohl die Nato-Perspektive der Ukraine, als auch die Rückeroberung der Krim als Ziele genannt wurden und im Januar dieses Jahres [Anmerkung Redaktion: 2022] hat die NATO die Ukraine eingeladen an der Nato-Agenda mitzuarbeiten.
Also am Strategiepapier der NATO. So viel zum offensichtlichen Vorlauf, der nicht zur Rechtfertigung gedacht ist, nur zur Vervollständigung des Gesamtbildes. Bitte nicht missverstehen. Ich denke es lohnte die Mühe mit allem was Journalisten an Recherche-Möglichkeiten zur Verfügung steht, dieser Frage: Warum der Überfall zu diesem Zeitpunkt?
Dieser Frage ohne ideologische Scheuklappen und ergebnisoffen nachzugehen. Entsprechende gut ausgestattete Netzwerke gibt es ja. Um das noch mal ganz deutlich zu sagen. Es geht mir in keiner Weise darum, diesen Krieg zu rechtfertigen. Bitte nehmen Sie das zur Kenntnis. Ich halte Krieg grundsätzlich für keine Option in unserer sogenannten zivilisierten Welt und habe auch für diesen Krieg keinerlei Verständnis.
Es lässt sich… nicht darüber streiten, ob es gerechte Kriege gibt mit ernstzunehmenden Argumenten auf beiden Seiten. Ich gehöre zu denjenigen, die auch sogenannt gerechte Kriege ablehnen, weil ich sie letztlich für eine Schimäre halte, die nur dazu dient, die eigene Hilflosigkeit der Menschheit zu beruhigen…
… Ein gerechter Krieg bringt den Menschen um… Es gibt im Zweifel eben keine Erlösung. Was ist denn mit Libyen? Was ist denn mit Syrien? Was ist denn mit Afghanistan? Wenn man diesen Kriegen überhaupt die Bezeichnung gerecht geben sollte.
Aber zurück zu Russland und der Ukraine und der derzeitigen Situation: Vor gut fünf Jahren ist mein Buch Eiszeit erschienen und der Untertitel lautet, wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist.
Warum das so gefährlich ist, das sehen wir jetzt. Ich habe in diesem Buch unter anderem dargelegt, dass Russlands aggressives Verhalten aus einer strategischen Defensive heraus entstanden ist…
… und da möchte ich Steven… zitieren [Anmerkung Redaktion: Wir haben den Namen im Vortrag nicht ganz verstanden], Harvard Professor für internationale Beziehungen, der auf folgenden Sachverhalte hingewiesen hat: Er hat gesagt, es gibt für Staaten zwei sehr unterschiedliche Gründe sich so zu verhalten, dass es für andere Staaten bedrohlich erscheint:
Zum einen, sind das Gier, Ruhmsucht oder Expansionsdrang aus ideologischen Gründen. Das beste Beispiel hierfür wäre Hitler. De zweite Variante hängt mit Furcht und Unsicherheit zusammen, die Staaten so agieren lassen, dass es aggressiv aussieht und bedrohlich wirkt.
Die Schwierigkeit besteht nun darin, dass die politische Reaktion darauf unterschiedlich ausfallen muss, je nachdem worum es sich handelt. Was im ersten Fall angezeigt ist: warnen, drohen, abschrecken, ist im zweiten Fall kontraproduktiv, da ist das ohnehin vorhandene Unsicherheitsgefühl verstärkt und die Reaktion noch aggressiver ausfällt.
Das heißt: die Gegenseite fühlt sich noch mehr bedroht also die klassische Eskalationsspirale in der wir uns schon vor dem Krieg befunden haben. Die entscheidende Frage ist und bleibt: Wie geht Deutschland, wie geht der politische Westen mit Russland um, angesichts der Tatsache das einerseits der Überfall auf die Ukraine inakzeptabel ist, wir aber andererseits als Nachbarn aufeinander angewiesen sind.
Ich glaube, es war Egon Bahr, der Architekt der neuen deutschen Ostpolitik Ende der 1960er, Anfang der 1970Jahre, der gesagt hat. Wir können politisch alles mögliche ändern, aber nicht die Geographie.
Das ist ja auch ein Grund dafür, das US-amerikanische Interessen zwangsläufig andere sind, als europäische. Da liegt ein breiter Ozean dazwischen. Jetzt haben wir folgende bizarre Situation. Ausgerechnet denjenigen, die sich in der Vergangenheit für Entspannungspolitik eingesetzt haben, wird auf breiter Front eine Mitschuld an diesem Krieg vorgeworfen.
Das gipfelt in unflätigsten Angriffen auf unseren derzeitigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, der wegen seiner früheren Russland-Politik zu Kreuze kriechen soll und vom ukrainischen Führungspersonal, nicht zuletzt vom noch ukrainischen Botschafter in Deutschland, wie in wie ich finde, schwer erträglicherweise beleidigt wird. Pardon, aber mir erschließt sich diese Logik nicht.
Denn es waren doch gerade die Entspannungspolitiker, die sich in den letzten 30 Jahren mit ihrer Politik eben nicht haben durchsetzen können. Es waren doch gerade die Entspannungspolitiker, die immer davor gewarnt haben, Russland noch weiter in die Ecke zu treiben, russische Sicherheitsinteressen nicht ernst zu nehmen. Wie kann man die dann für das jetzige Desaster mitverantwortlich machen? Und was Sicherheit und Russland betrifft: Auch Russland hat ein Recht auf seine Sicherheit, wie jedes andere Land der Welt auch. In internationalen Verträgen mit Russland zum Beispiel Istanbul 1999, dann danach 2004, ist sogar festgeschrieben, dass die Sicherheit des einen Landes nicht auf Kosten der Sicherheit des anderen Landes hergestellt werden darf.
Ich werde mich jetzt nicht lange mit Schuldzuweisungen aufhalten, nach dem Motto: Die Hardliner, die sind schuld und die Nato-Ost-Erweiterer, das führt zu nichts. Aber es ist mir wichtig diese angebliche Mitverantwortung von Entspannungspolitikern zu bezweifeln. Denn dieser Gedanke kommt in der veröffentlichten Meinung eher weniger vor und es ist gerade mit Blick auf die Zukunft wichtig zu analysieren, warum es so weit gekommen ist?
Damit man ähnliche Fehler nach Möglichkeit vermeidet. Montesquieu, der geschätzte Staatstheoretiker und Philosoph der Aufklärung, der hat schon damals den Kern des Problems deutlich gemacht. Er hat sinngemäß gesagt, man dürfe in Sachen des Krieges nicht die offensichtlichen Ursachen mit den tieferen Ursachen verwechseln und man dürfe diejenigen die den Krieg ausgelöst haben, nicht mit denjenigen verwechseln, die ihn unvermeidlich gemacht haben.
Und Montesquieu kann man aus ganz praktischen Gründen keine Putin-Komplizenschaft unterstellen. Er ist immerhin Ende des 17 Jahrhunderts geboren. Eigentlich müsste jedem einleuchten, dass man die Ursachen kennen muss, um die Zusammenhänge zu verstehen, wenn man an einer funktionierenden Sicherheitsarchitektur ernsthaft interessiert ist.
Wenn Sie bitte mal zurückdenken, nach einer Zeit der Entspannung, der Hoffnung auf eine neue friedliche Weltordnung. Sie erinnern sich alle noch an Gorbatschow und seine Perestroika Politik und an die Euphorie: jetzt ist endlich das Konfrontationsdenken vorbei. Jetzt können wir endlich gemeinsam an einem europäischen Haus bauen.
Das ist lange her. Nach dieser Zeit der Entspannung und der Hoffnung, standen wir schon lange vor dem Krieg vor einem großen Scherbenhaufen. Das gegenseitige Misstrauen wuchs und wuchs. Und die vorherrschende Meinung im Westen ist, dass nur Russland dafür Verantwortung trägt. Etwa durch die Unterstützung des Assad-Regimes in Syrien, die Intervention in der Ukraine, die Angliederung der Krim, die Modernisierung der Streitkräfte.
Aber die Sache ist wesentlich komplizierter. Denn diese Sichtweise unterschlägt den westlichen Anteil, den es ja auch gibt. Das ist aber entscheidend für die Antwort auf die Frage welche Politik gegenüber Russland betrieben werden soll.
Fakt ist, dass nach der Auflösung der Sowjetunion russische Interessen entweder nicht ernst genommen oder gleich als illegitim beiseitegeschoben worden sind. Aber man hat Vladimir Putin in seiner ersten Amtszeit mit seinen vielfältigen Versuchen auflaufen lassen, die Verbindungen mit dem Westen zu stärken.
Das wollen viele heute nicht mehr wahrhaben. Aber das lässt sich im Einzelnen belegen. darüber gibt es nichts zu streiten. Gleichzeitig hat die NATO ihre Politik durchgezogen. Wobei Deutschland immer wieder mäßigend gewirkt hat. Sehr zum Ärger Washingtons und seiner osteuropäischen Verbündeten. Die NATO Ost-Erweiterung war einer der größten Fehler nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das hat unter anderem auch der langjährige deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher so gesehen.
Und was vielleicht noch aussagekräftiger ist: Selbst George F. Kennan, im Grunde der Architekt amerikanischer Eindämmungspolitik, der hat gesagt, ich zitiere wörtlich: Ich denke, das ist ein tragischer Fehler. Es gab überhaupt keinen Grund dafür. Niemand bedrohte irgendjemanden. Und etwas weiter heißt es bei ihm: ‚Natürlich wird es darauf zukünftig eine böse Reaktion durch Russland geben. Und dann werden sie, die Nato-Erweiterer, sagen: So sind die Russen, das haben wir euch immer gesagt. Aber das ist komplett falsch‘.
George Kennan, den man meines Wissens nicht mit der heutigen Bedeutung des Begriffes Russlandversteher in Verbindung bringt.
Mit der Nato-Perspektive für die Ukraine war dann die Schmerzgrenze für Russland überschritten.
Das Tragische daran: Der Krieg war erst ein paar Tage alt, als sich der ukrainische Präsident öffentlich äußerte, man könne sich einen neutralen Status der Ukraine vorstellen. Das hätte man vorher haben können. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle gerne eine Passage aus „Eiszeit“ zur Kenntnis bringen, wegen der Authentizität:
Die gegenwärtige Strategie der NATO, wie gesagt gut fünf Jahre her: Die gegenwärtige Strategie der NATO beruht darauf, eine russischen Politik, die als expansiv wahrgenommen, wird, mit Stärke entgegenzutreten…
Wenn die NATO Schwäche zeigt, fühlt sich Putin dagegen ermutigt, die baltischen Staaten anzugreifen. Dann muss die NATO Krieg führen und die Kosten sind viel höher, als jetzt für die erhöhte militärische Präsenz.
Das mag für manchen logisch klingen. Doch diese Politik beruht auf einer dramatischen Fehleinschätzung. Wie bereits ausführlich dargelegt, verfolgt Russland keine aggressive Expansionspolitik, sondern handelt aus einer strategischen Defensive heraus.
Russland will sich gegen eine Politik der NATO verteidigen, die es als aggressiv wahrnimmt. Es sieht den Westen nicht mehr als Partner und misstraut seinen Motiven. Wenn man so will: Moskau versucht aus einer Position der Schwäche heraus, seine Verteidigungsfähigkeit wiederherzustellen. Dazu dienen die Modernisierung des Militärs, die Aufrüstung der Enklave Kaliningrad, die Übungen wie Sapa 2017, bei der eine Invasion der NATO in Weißrussland angenommen wird, sowie die Modernisierung der Nuklearstreitkräfte und der U-Bootflotte, um die Zweitschlagkapazität zu sichern.
Genau, wie zu Zeiten Ronald Reagans, belauern sich beide Seiten misstrauisch und schließen nicht aus, dass der Gegner den Finger am Abzug hat. Wie kommt man aus dieser gefährlichen Situation wieder heraus? Jedenfalls nicht durch eine Politik der Stärke, die alles immer nur noch schlimmer macht.
Dringend nötig hingegen ist eine Politik der Entspannung und der Vertrauensbildung. Wenn die Eskalationsspirale sich immer schneller dreht und kaum noch Vertrauen übrig ist, muss sich eine Seite bewegen um den Teufelskreis zu durchbrechen.
In der Vergangenheit ist das gar nicht so selten Russland gewesen. John F Kennedy hätte es in der Kubakrise auf den Atomkrieg ankommen lassen, um keine Schwäche zu zeigen. Hätte der Kreml unter [Nikita] Chruschtschow nicht nachgegeben, sehe die Welt heute sicherlich ganz anders aus und auch [Ronald] Reagan hatte das Glück, seit 1985 mit Michael Gorbatschow einen Gegenspieler zu haben, der bereit war, auf Gewaltanwendung zu verzichten und das sowjetische Imperium friedlich aufzugeben.
Das war ein historisch nahezu ein einmaliger Vorgang. Wollen wir wirklich darauf vertrauen, dass auch diesmal wieder irgendwie alles gut geht. Nehmen wir an, Putin würde entsprechende erste Schritte auf den Westen zu unternehmen. Wären wir überhaupt noch in der Lage, sie als solche zu erkennen? Und gibt nicht normalerweise der Klügere nach? Wir halten uns doch eindeutig für die Klügeren, die moralisch überlegenen. Oder nicht? Dann müssten die Schritte zu Entspannung eigentlich vom Westen ausgehen. Zumal er in den letzten Jahren agiert hat, während Russland reagierte.
Da sie ja den Vorlauf bis zu dieser Stelle im Buch nicht kennen und vielleicht etwas irritiert sind, wenn ich von strategischer Defensive und von reaktiven Verhalten Russlands Rede, möchte ich jetzt mit ein paar Falschbehauptungen aufräumen, die es bis in höchster Kreise geschafft haben und die in den Medien aus welchen Gründen auch immer gebetsmühlenartig wiederholt werden.
Dazu gehört die Behauptung, Russland habe Georgien überfallen. Der Georgienkrieg sei also 2008 durch russische Aggression ausgelöst worden. Das ist definitiv nicht der Fall, wie man in den entsprechenden Dokumenten der Fact Finding Mission nachlesen kann. Das ist ein Papier das im Auftrag der EU entstanden ist unter der Federführung der Schweizer Diplomatin Heidi Tagliavini: Georgien war der Aggressor und Russland hat zurückgeschlagen. Aber unbeirrt wird der Georgienkrieg als Beispiel für russische Aggression genannt, nach dem Motto: Na, da haben die das ja auch schon so gemacht.
Für mich unfassbar, dass es auch hochrangige Experten, wie etwa die frühere NATO Planungschefin Stefanie Babs, die immer wieder um ihre Einschätzung gefragt wird, das es auch hochrangige Experten mit dem Brustton der Überzeugung ständig wiederholen.
Fakt ist, das Georgien angegriffen hat und nicht umgekehrt. Es hatte schon 2004 und 2006 militärische Operationen der Georgier gegeben und der UN-Sicherheitsrat hat daraufhin sogar eine Resolution verabschiedet mit der Aufforderung an Georgien solches künftig zu unterlassen.
Und wie paradox es hin und wieder zugeht, das mögen sie daraus ersehen, dass es Phasen gab, in denen ausgerechnet der amerikanische Botschafter in Georgien damit beschäftigt war, den dortigen Präsidenten von allzu groben Provokationen gegen Russland abzuhalten. Denn die USA brauchten Russland wegen diverser andere Probleme auf der Welt eben irgendwie doch.
Die Chronologie der ganzen Geschichte habe ich unter Berufung auf d-klassifizierte Akten und geleakte E-Mails ausführlich beschriebe. Innerhalb von drei Tagen gab es jedenfalls 800 zivile Opfer.
Oder nehmen Sie Syrien: Nicht auszudenken, was Syrien vermutlich alles erspart geblieben wäre, wenn man Russland gleich zu Beginn der Unruhen ins Boot geholt hätte. Aber das westliche Mantra lautete ja schlicht: Assad muss weg und geredet wird nur mit der Opposition, die es so nie gab. Das Tragische und infame bei Syrien besteht in folgendem.
Dieser hochkomplizierte Konflikt in dieser hochkomplizierten Gegend wurde auf eine einfache moralische Aussage reduziert: Assad ist ein Verbrecher, die Russen wollen Assad unterstützen, sind also auch nicht besser als der, und wir wollen das syrische Volk befreien.
Und schon ist eine völlig irreale Konfliktlinie gezogen…. eine wirklich völlig irreale Konfliktlinie, die weder der Realität entspricht, noch den Menschen in Syrien irgendeinen Vorteil gebracht hat.
Im Gegenteil. Dabei wird ja ständig mit Menschenrechten und dem Wohl von Menschen argumentiert. Wenn es wirklich darum ginge, dann hätte man die Kontakte Russlands zu Syrien nutzen müssen, statt sie von vornherein zu verteufeln.
Hat noch irgendjemand auf dem Schirm, dass die Vernichtung chemischer Kampfstoffe in Syrien nur mit Hilfe Russlands funktioniert hat? Man vergisst das alles so schnell. Wir standen Stunden vor einem amerikanischen Militärschlag, weil Obama damals eine von diesen roten Linien gezogen hatte und dann hat Assad plötzlich und unerwartet die Chemiewaffenkonvention unterschrieben und dem Abtransport und der Vernichtung der Waffen zugestimmt, was ja teilweise auf amerikanischen Schiffen im Mittelmeer dann auch passiert ist.
Ohne Russland hätte sich da gar nichts bewegt. Diese Dinge sind schnell vergessen. Diese Dinge produzieren ja auch keine eindringlichen Bilder. Die Hölle von Aleppo schon. Der Kampf um Aleppo wird Russland noch lange nachhängen und anhängen. Ich will das weder in die eine noch in die andere Richtung kommentieren. Aber haben sie die grauenvollen Ereignisse in Rakka noch genauso in Erinnerung wie in Aleppo? Und die durch den Sturm auf Mossul im Nordirak?
Oder geht das nicht so tief, weil wir als Alliierte der USA indirekt beteiligt waren? Laut der britischen Zeitschrift The Independent hat dieser Sturm auf Mossul 40.000 Zivilisten das Leben gekostet. Ich habe mal nachgeschaut, wie viel Einwohner Reutlingen hat und habe die Zahl 1150.000 gefunden. Dann müssen Sie sich bitte etwa ein Drittel ihrer Bevölkerung wegdenken. Hin und wieder schützt ein wenig Selbstreflexion vor Radikalisierung.
Zurück zu Russland und zur Ukraine: Es scheint mir wichtig zu wissen, dass das Gebiet der heutigen Ukraine nie ausschließlich von Menschen bewohnt wurde, die sich als Ukrainer begriffen. Aufgrund der geografischen Lage und der wechselvollen Geschichte dieses Gebietes gab es dort immer starke ethnische und auch religiöse Minderheiten.
Seien es Russen, Polen, Deutsche, Rumänen, Tschechen oder Juden und Muslime. Als die Sowjetunion entstand, existierte eine westukrainische Volksrepublik auf dem ehemals habsburgischen Territorium nach dem Zusammenbruch von Österreich-Ungarn und eine ukrainische Volksrepublik aus der Konkursmasse des russischen Reiches.
Beide Republiken wurden in dieser Zeit sowohl von der im entstehenden begriffenen Sowjetunion als auch von Ländern wie Polen Rumänien und der Tschechoslowakei bedrängt. Der größere Teil der heutigen Ukraine wurde dann im Dezember 1922 zur Sowjetrepublik
Die Ukraine, wie wir sie heute kennen existiert seit 1991, also gut seit 30 Jahre. Ein Problem der ukrainischen Identität besteht darin, dass der Ukraine eine historische Kontinuität der Staatlichkeit fehlt. Diese treffende Formulierung stammt nicht von mir, sondern aus einem Artikel, den ich neulich in diesem Zusammenhang gelesen habe. Die vielfältigen Zugehörigkeiten und damit verbundenen vielfältigen Beziehungen zu unterschiedlichen Nachbarstaaten machen es einfach hochgradig kompliziert. Das hat ja nichts damit zu tun der Ukraine hier Existenzrecht abzusprechen.
Die Dinge sind nur nicht so platt, wie sie hin und wieder in politischen Auseinandersetzungen zu sein scheinen. Es gibt nicht nur die Wahl zwischen zwei Extremen entweder der Ukraine ihr Existenzrecht abzusprechen oder andererseits so zu tun, als handele es sich um einen monolithischen Block ohne Fliehkräfte. Wenn innerhalb der Ukraine nach der Auflösung der Sowjetunion eine Dezentralisierung gelungen wäre, die den historischen Entwicklungen Rechnung getragen hätte und dieses Land seine Rolle als Brücke zwischen West und Ost hätte spielen können, es wäre sicher nicht zum Schaden der Ukraine gewesen. Ganz im Gegenteil. Wenn sie jetzt einwenden wollen:
hätte, hätte das bringt ja alles nichts. Ganz so ist es nicht. Denn eine unaufgeregte Analyse der Vergangenheit ist die unbedingte Voraussetzung für eine friedliche Perspektive. Diese Dinge zu ignorieren, führt zu Geschichtsklitterung als Basis für Radikalisierung. Und damit ist niemandem gedient.
Am allerwenigsten den Menschen in der Ukraine. Dreh- und Angelpunkt in der derzeitigen Diskussion sind Begriffe wie sicherheits-Architektur und Sicherheits-Interessen. Ich lasse die USA jetzt mal außen vor und schaue auf die EU. Man muss leider feststellen, dass es der EU nicht gelungen ist, den historisch verständlichen Ängsten von Polen und Balken auf der einen Seite. Und den historisch verständlichen Ängsten Russlands mit einer konstruktiven Politik zu begegnen, die Interessenausgleich und Friedenssicherung als Ziel hat.
Wir haben uns durch die Aufnahme osteuropäischer Länder in die EU, grundsätzlich eine super Idee, deren Probleme mit Russland ins Bündnis geholt. Und in der NATO haben wir genau das gleiche. Es ist ein Jammer, dass sich die EU ihr ursprünglich recht gutes Verhältnis mit Russland dadurch ruiniert hat. Denn Moskau funktioniert für die genannten Länder nach wie vor als Synonym für Sowjetunion und schlimme Erinnerungen an sowjetische Zeiten.
Aber so macht man keine zukunftsorientierte Friedenspolitik. Das hätte der EU vielleicht früh auffallen können. Stattdessen hat sie ausgerechnet diesen Ländern immer mehr das Sagen in der europäischen Außenpolitik gegenüber Russland überlassen. Es sind neben den USA genau diese Länder, die in der Vergangenheit auch lange vor dem Krieg am heftigsten nach Sanktionen verlangt und einer Konfrontationspolitik mit Russland immer den Vorzug gegeben haben.
Wie groß der, wie ich finde, schädliche Einfluss ist, lässt sich gut an folgendem Beispiel zeigen: Im vergangenen Herbst haben die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron gemeinsam vorgeschlagen, immerhin die Chefs der beiden mächtigsten EU-Länder, sich auf EU-Ebene mit dem russischen Präsidenten zu treffen. Vielleicht erinnern Sie sich. Es gab ja wahrlich einiges zu besprechen und zu klären. Das Timing stimmte, denn kurz zuvor hatten sich der amerikanische Präsident Biden und Putin in Genf getroffen.
Die USA hätten also nichts dagegen haben können, nach dem Motto: Keine europäischen Alleingänge, vor dem Transatlantiker ja immer warnen. Also intelligentes Timing. Alles stimmt und das ganze scheitert dann daran, dass eine wirklich kleine Minderheit in der EU diesen Plan ablehnt und die Idee blockiert.
Ich will die Frage stellen dürfen, ohne sie beantworten zu müssen: Wie steht es denn da um die Mitverantwortung mit Blick auf den Krieg in der Ukraine? Nur um den Denkhorizont zu erweitern noch ein Wort zu persönlichen Gesprächen, beziehungsweise zur Ablehnung oder Verweigerung derselben: Meiner Meinung nach sollte überhaupt alles an Dialogforen was es gibt, was aber zum Teil seit Jahren lange vor dem Krieg auf Eis liegt, wieder aktiviert werden.
Und ich möchte erklären, wieso. Diejenigen, mit denen man sich gut versteht, die muss man nicht unbedingt persönlich treffen, da genügend gelegentliche Telefonate oder Schriftwechsel.
Aber mit denen, wo es Probleme gibt, mit denen muss man sich persönlich treffen. Alles andere funktioniert nicht. Vorausgesetzt natürlich, man hat die Lösung der Probleme im Blick und nicht das Befolgen vermeintlich moralisch gebotene Prinzipien.
Es geht weiter mit den Sicherheitsinteressen und ich mute ihnen erneut einen Perspektivwechsel zu, bevor ich versuche die konstruktive Kurve zu kriegen. Dazu wieder ein kleiner Ausschnitt aus „Eiszeit“ und bitte nicht vergessen das ist vor gut fünf Jahren erschienen: Wenn sich Moskau durch die NATO eingekreist sieht, ist das wirklich so abwegig?
- Ein Blick auf die Landkarte mag hier helfen: an Russlands Westgrenze befinden sich die europäischen NATO-Staaten und die USA mit ihren zahlreichen Militärbasen in Europa. Nebenbei, das steht da nicht, Russland hat nur 11 Stützpunkte außerhalb des eigenen Landes, davon neun in unmittelbarer Nähe Russlands.
- Die USA – haben sie eine Vorstellung ? – unterhalten knapp 800 Stützpunkte in etwa 70 Ländern dieser Welt. Jetzt wieder „Eiszeit“: Rumänien und Polen sind die Standorte für das Raketenabwehrsystem. Den Ausgang der Ostsee kontrollieren im Konfliktfall die NATO-Mitglieder Deutschland, Dänemark und Norwegen und jetzt demnächst wohl auch Schweden und Finnland.
Im Südwesten Russlands wacht das NATO-Mitglied Türkei über den Ausgang des Schwarzen Meeres. Hier betreiben die USA eine Radaranlage für das Raketenabwehrsystem und sie nutzen den großen Luftwaffenstützpunkt Incirlik, denn die Deutschen im Sommer 2017 wegen des Besuchsverbots für Parlamentarier verlassen haben.
Wenn wir in den Norden schauen: Selbst der Zugang Russlands von der Barentssee aus zum Nordatlantik wäre im Konfliktfall hochgradig gefährdet, denn da stehen die NATO-Mitglieder Island, Großbritannien und Norwegen bereit. Seit 2016 gibt es ein Abkommen zwischen Island und den USA das den Amerikanern gestattet einen Marinefliegerstützpunkt den sie 2006 geschlossen hatten, wieder nutzen zu können. Dort sollen Poseidon Flugzeuge für die Seeaufklärung insbesondere für die U-Boot Jagd versorgt werden können und möglicherweise auch fest stationiert werden.
Und in Großbritannien unterhalten die USA ohnehin mehrere Luftwaffenstützpunkte. Und was Norwegen betrifft, da sind Anfang 2017 erstmals 330 US-Soldaten stationiert worden. Norwegen war schon 1949 der NATO beigetreten, allerdings unter der Bedingung, dass keine NATO-Truppen dauerhaft in dem Land stationiert werden.
Norwegen argumentiert jetzt: Die amerikanischen Soldaten würden ja regelmäßig ausgetauscht und der Stützpunkt auf dem sie untergebracht sind bleibe weiterhin unter norwegischem Kommando. Außerdem entsteht auf der arktischen Insel Wardow am nordöstlichsten Zipfel Norwegens derzeit eine sehr leistungsfähige aus den USA finanzierte Radaranlage mit der die Bewegungen russischer U-Boote in der Arktis besser verfolgt werden können.
Russland ist alarmiert, denn die nukleare U-Boot-Flotte in der Arktis ist ein elementarer Bestandteil seiner Zweitschlagfähigkeit und damit seiner nuklearen Abschreckung.
Im Süden Russlands unterhalten die USA und die NATO enge militärische Verbindungen zu Georgien. Dort fand zum Beispiel 2016 ein gemeinsames Manöver georgischer, amerikanischer und britischer Truppen unter amerikanischer Führung statt. Und im Sommer 2017 richtete Georgien das Manöver Noble Partner aus, an dem unter anderem auch deutsche Truppen beteiligt waren.
Ebenfalls im Süden Russlands sind die USA und die NATO wegen des Krieges in Afghanistan massiv militärisch präsent. Das hat sich jetzt geändert, da tut sich also eine kleine Lücke auf. Im Südosten Russlands befinden sich die amerikanischen Verbündeten Südkorea und Japan mit zahlreichen amerikanischen Militärstützpunkten und im Osten Russlands liegt Alaska.
Im Falle eines Konfliktes mit den USA und der NATO müsste Russland damit rechnen von seinen eigenen Häfen aus keinen Zugang mehr zu den Weltmeeren zu haben. Eine kluge Sicherheitspolitik müsste also die verständlichen Ängste der Balken und Polen mit den ebenso verständlichen Ängsten der Russen austarieren. Das ist aber nicht einmal im Ansatz auf irgendeiner Agenda zu finden.
Stattdessen stellen sich der Westen und die NATO klar auf eine Seite: Hier zeigt sich zum wiederholten Male, wie fatal die NATO-Osterweiterung war. Denn sie hat aufgrund ihrer geostrategischen Folgen nicht nur die Beziehungen zwischen der Nato und Russland belastet. Sie hat durch die Aufnahme der osteuropäischen Länder auch deren Konflikte mit Russland ins Bündnis geholt und so wurde das Verhältnis zu Moskau nach und nach vergiftet.
Das Misstrauen, das in den baltischen Staaten und Polen gegenüber Moskau herrscht, hat sich nachhaltig in die NATO hineingefressen und die Kompromissbereitschaft gegenüber Russland stark reduziert. Deshalb wird es eine neue Initiative in Richtung Entspannungspolitik gegenüber Russland heute ungleich schwerer haben, als in der 1960er Jahren. Es ist ein sehr dickes politisches Brett, dass es hier zu bohren gilt und Deutschland hat dabei sowohl eine besondere historische Verantwortung, als auch eine nach wie vor besonders gute Ausgangsposition vor fünf Jahren.
Denn zusammen mit Paris hat Berlin in den letzten Jahren viel dazu beigetragen weitere Eskalationen zu vermeiden und die Gesprächskanäle nach Moskau wenigstens offen zu halten. Jetzt geht es allerdings nicht mehr bloß darum, Schlimmeres zu verhindern, wie zum Beispiel Waffenlieferungen an Kiew und den NATO-Beitritt von Georgien und der Ukraine, sondern um handfeste Signale in Richtung Entspannung, die von substanziellen Zugeständnissen begleitet werden.
Das wird, falls es politisch überhaupt durchsetzbar ist, ein harter Kampf. wenn man sich vor Augen führt, wie massiv Politiker wie etwa Frank-Walter Steinmeier bereits für die gegenwärtige Politik angegriffen worden sind.
Aber es ist längst überfällig, diese Auseinandersetzung im eigenen Land und im Bündnis zu führen. Wenn wir aus der Eskalationsspirale aussteigen wollen. Es wird höchste Zeit für eine Initiative der westeuropäischen NATO-Länder, um der amerikanischen und osteuropäischen Konfrontationspolitik etwas Konstruktives entgegenzusetzen.
Wie damals beim Harmel-Bericht. Wir brauchen dringend eine politische Initiative in Richtung Entspannung. Jetzt wieder neu: Der er Harmel-Bericht. Das war eine Initiative des damaligen belgischen Außenministers Pierre Harmel [Redaktions-Anmerkung: 1966–1973]. Das war 1967, also in einer Phase des Wettrüstens und auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Und Ziel war eine dauerhafte und gerechte Friedensordnung in Europa und seitdem verfolgte die NATO eine Doppelstrategie. Einerseits militärische Stärke zu zeigen. Sich aber andererseits auf der politischen Ebene für Entspannung, Abrüstung und Zusammenarbeit zu bemühen.
Militärische Stärke und Entspannung das muss kein Gegensatz sein. Das ist kein Widerspruch und auch der Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat ja bis vor kurzem immer wieder die Dialogbereitschaft betont. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen damals und heute.
- Im Harmelbericht von vor 55 Jahren wurde die Doppelstrategie der NATO gegenüber Russland mit Sicherheit und Entspannung umschrieben. Heute lauten die entsprechenden Begriffe Abschreckung und Dialog.
Abschreckung ist ein aggressiver, Sicherheit ein defensiver Begriff. Dialog verkommt zur Lehrformel, wenn man die Interessen des Gegenübers als illegitim betrachtet.
Entspannung steht dagegen für ein Programm für einen umfassenden politischen Ansatz. Der Qualitätsunterschied zwischen der Politik damals und heute ist allein in der Begrifflichkeit erkennbar.
Heute ist auch das gelaufen. Aus dem strategischen Partner Russland ist laut neuestem Nato-Papier die größte Bedrohung geworden. Wenn man sich Gedanken darüber macht, wie der Krieg beendet werden kann, beziehungsweise wie eine politische Lösung für die Zeit nach dem Krieg aussehen könnte, dann kommt man an zwei Komplexen nicht vorbei: Der erste betrifft die Abrüstungsverträge. Und der zweite bezieht sich auf das, was man mit Minsker Vereinbarungen bezeichnet.
- Fangen wir mit den Minsker Vereinbarungen an.
- Die Verdienste sowohl von Minsk 1 als auch von Minsk 2 liegen darin, das damals weitere militärische Auseinandersetzungen in und um die Ukraine verhindert werden konnten und Waffenruhen vereinbart wurden, die trotz mancher Vertragsverletzungen von beiden Seiten das Blutvergießen dennoch etwas reduzierten und die Verdienste liegen darin, dass eine Perspektive geschaffen wurde für eine friedliche Koexistenz zwischen Kiew und den eher nach Russland tendierenden östlichen Teilen der Ukraine.
Die Krux dieser Vereinbarung besteht darin, dass über die Reihenfolge gestritten wurde in der die einzelnen Punkte umgesetzt werden sollten.
- Ein Punkt sah zum Beispiel die lokale Selbstverwaltung im Donetzka und Luganska Gebiet vor und verpflichtete die Ukraine innerhalb von 30 Tagen nach Vertragsunterzeichnung darüber im Parlament auch einen Beschluss herbeizuführen.
- Das wäre also im März 2015 fällig gewesen.
- Ein weiterer Punkt legte fest, dass sämtliche sozialen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen diesen Regionen und Kiew wiederhergestellt werden sollten.
- Dazu muss man wissen, dass zum Beispiel alle Rentenzahlungen eingestellt worden waren, dass es keinen Bankverkehr mehr gab, dass alle Energielieferungen gekappt waren, also all das sollte wieder hergestellt werden.
- Russland beklagte immer wieder, dass die Ukraine nichts davon umgesetzt habe, aber im Gegensatz zu Russland mit keinerlei Sanktionen belegt worden war.
Bis Kriegsbeginn sind ja immerhin sieben Jahre vergangen. Die ukrainische Seite wiederum legte ihren Fokus auf einen ganz anderen Punkt in dem festgelegt wurde, das im gesamten Konfliktgebiet die vollständige Kontrolle über die Staatsgrenze durch die Ukraine, also Kiew, wiederhergestellt werden sollte und zwar bis Ende 2015, allerdings vorausgesetzt, ein weiterer Punkt sei bis dahin erledigt, der der Ukraine vorschrieb, ihre Verfassung zu reformieren entsprechend und sie ebenfalls bis Ende 2015 in Kraft zu setzen.
So nichts davon, nichts davon, ist geschehen und beide Seiten machen die jeweils andere Seite dafür verantwortlich. So oder so muss man festhalten, dass die Umsetzung von Minsk 2 zwar sehr wohl im russischen Interesse lag, aber keinesfalls im ukrainischen und die Gründe für beide Positionen liegen auf der Hand:
Wenn Minsk 2 umgesetzt worden wäre, dann hätte Russland die umstrittenen Gebiete als ukrainisches Territorium anerkennen und trotzdem Einfluss behalten können. Aber solange sich nichts bewegte, wurden die weltweiten Sanktionen gegen Russland aufrechterhalten, was man in Kiew begrüßte. In der Ukraine ist zudem die Auffassung weit verbreitet, man habe die Minsker Vereinbarungen damals quasi in einer Notlage unterzeichnet und das völlige Desaster der ukrainischen Armee abzuwenden, das ohne die ausgehandelten Feuerpausen unmittelbar bevorstand.
Es galt also Zeit zu gewinnen, was ja auch gelungen ist. Denn die Ausstattung und die Kampfkraft der ukrainischen Armee heute, und zwar nicht erst seit Kriegsbeginn, ist angesichts der massiven Waffenlieferungen durch westliche Länder in den letzten Jahren eine vollkommen andere, als damals.
Im Nachhinein nützt das nichts, klar. Aber vielleicht hätte der Westen Moskau und Kiew gleichermaßen unter Druck setzen sollen, um Minsk umzusetzen, statt des schleifen zu lassen nach dem Motto: Der Schurke sitzt sowieso in Moskau….“
Ende der ersten rund 50 Minuten des Vortrages von Gabriele Krone-Schmalz. Den ganzen Vortrag könnt Ihr auf YouTube euch selber anschauen:
 272
272